Was ist
In fünf Tagen ist die Bundestagswahl. Während in gefühlt fünfhundersechsundachtzig Talkshows immer und immer wieder über Migration gestritten wird, kommen andere Themen deutlich zu kurz. Über Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung wird so gut wie gar nicht diskutiert.
Dabei sollten eigentlich spätestens nach dem Auftritt des US-Vizepräsidenten JD Vance bei der Münchener Sicherheitskonferenz die Themen Desinformation, Medienkompetenz und Plattform-Regulierung ganz oben auf der Agenda stehen.
Kurzer Recap: Vance hatte den anwesenden Politikerïnnen wenig über das Sicherheitsgefüge in Europa und Nahost zu sagen. Dafür halluzinierte er ein mangelndes Demokratie-Verständnis der Europäer herbei und forderte explizit in Richtung Deutschland, Brandmauern einzureißen und mit der AfD zu kooperieren. Die wahre Bedrohung sitze nicht in China oder Russland. Sie komme von den europäischen Regierungschefs, die sich für eine all zu große Regulierung der Social-Media-Plattformen stark machen.
Warum das wichtig ist
Viele Beobachterïnnen haben den Auftritt des US-Vize vor allem als sicherheitspolitische Kampfansage gelesen. Europa, so die Wahrnehmung, müsse nun endlich mehr für die eigene Verteidigung tun. Auf den Partner auf der anderen Seite des Atlantiks sei nur noch bedingt Verlass.
Diese Deutung ist sicherlich richtig und gerade auch mit Blick auf die Alleingänge der USA, was das Ende des Kriegs in der Ukraine angeht, mehr als angebracht. Aber wir sind weder Politik-Profis, noch Sicherheitsexperten. Uns interessiert die Schnittstelle von Social Media, Politik und Gesellschaft. Und hier hat Vance unmissverständlich klargemacht, wie die USA den Status quo von Social Media deuten: Weg mit den Regulierungen, es müsse wieder alles gesagt werden dürfen, Kollateralschäden inbegriffen. Alles andere sei ein Versuch, die freie Meinung zu unterdrücken, ergo der direkte Weg in die Diktatur.
Wie die USA es aktuell selbst mit der freien Meinungsäußerung halten, zeigen die Schlagzeilen der vergangenen Tage:
- How Elon Musk and the Right Are Trying to Recast Reporting as ‘Doxxing’ (New York Times)
- The White House bans the AP indefinitely over the use of ‘Gulf of Mexico’ (CNN)
- X challenges German court decision that forces it to share election data (Politico)
- Hungary’s transformation into an ‘electoral autocracy’ has parallels to Trump’s second term (AP News)
Weiß ist schwarz. Schwarz ist weiß.
Zur Orientierung: Die erste Amtszeit von Donald Trump war davon geprägt, dass Trump jeden Tag aufs Neue die Weltöffentlichkeit vor sich her trieb. Das ging ungefähr so: Trump twitterte morgens allerlei absurde Vorschläge, er schaute, was am meisten diskutiert wurde, um es am Abend bei Fox News zu verkünden und dann in republikanische Politik zu überführen.
Die zweite Amtszeit funktioniert anders: Er flutet die Social-Media-Plattformen mit Bildern und Tönen, die Handeln und Stärke demonstrieren sollen. Seien es die Dekrete, die er öffentlichkeitswirksam unterzeichnet. Oder die Polizeikolonnen, die Migrantïnnen aufspüren. Was nicht auf Social ist, ist nicht passiert. Es ist dabei aus seiner Sicht zunächst einmal vollkommen egal, ob all die Dinge durchgehen, die er in die Wege leitet. Es geht um die Bilder, die sein Handeln auslösen.
Da stört natürlich Gegenrede. Da stören Faktenchecks. Da stört Journalismus. Aus Trumps Sicht muss alles verschwinden, was ihn auf diesem Spielfeld zur Rechenschaft ziehen könnte. Es geht den USA nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um Machterhalt. Wenn sich niemand mehr auf eine gemeinsame Faktenlage einigen kann, dann gewinnt die gefühlte Wahrheit, dann gewinnt das, was man „gesehen“ hat.
Wenn Trumps Truppe also von „free speech“ redet, dann meinen sie in Wahrheit vor allem: Deregulierung.
Sind wir in Deutschland auf diese Form der durch Social-Media-Plattformen errichteten Präsidentschaft vorbereitet? Wie ernst nehmen die Parteien die digitalen Kommunikationstools? Wer spricht sich für Regulierung aus? Wer hätte gern mehr „Freiheit“? Unser Blick auf die Wahlprogramme:
Was im Wahlprogramm der SPD zu Social Media steht
- Im Wahlprogramm der SPD wird Social Media in mehreren Zusammenhängen behandelt, insbesondere in Bezug auf Transparenz, Desinformation und digitale Gewalt.
- Große Plattformen wie Instagram, TikTok und X sollen verpflichtet werden, ihre Algorithmen und Entscheidungsprozesse offenzulegen. Es soll überprüft werden, ob die Algorithmen diskriminierende oder manipulative Praktiken anwenden. Ziel sei es, die Verantwortung der Plattformanbieter zu stärken und den Einfluss von Social Media auf die Meinungsbildung transparenter zu machen.
- Die SPD setzt auf die Förderung von Medienkompetenz, um Nutzerïnnen besser gegen Manipulation zu schützen. Faktenchecks unabhängiger Medien sollen gestärkt werden. Eine staatliche Regulierung von Inhalten wird abgelehnt, um Zensurvorwürfe zu vermeiden.
- Die SPD fordert strengere Maßnahmen gegen digitale Gewalt, speziell gegen Hassrede und Hetze auf Social-Media-Plattformen. Anbieter sozialer Netzwerke sollen verpflichtet werden, effektiver gegen Hasskommentare vorzugehen und betroffene Nutzerïnnen besser zu schützen.
- Meinungsfreiheit wird als essenzieller Pfeiler der Demokratie gepriesen. Gleichzeitig sollen die Maßnahmen gegen Hass und Desinformation stets im Einklang mit einem offenen, pluralistischen Austausch stehen.
Was im Wahlprogramm der CDU zu Social Media steht
- Die CDU betont den Schutz der individuellen Freiheit und der Meinungsfreiheit im Internet.
- Zugleich soll die Verantwortung der Betreiber sozialer Netzwerke klar geregelt werden – etwa durch Maßnahmen, die sicherstellen, dass Plattformen gegen Hassrede und Desinformation vorgehen, ohne dabei den wirtschaftlichen Fortschritt oder die freie Meinungsäußerung übermäßig einzuschränken.
- Das Thema soziale Medien wird aber vor allem im Kontext des Schutzes von Kindern und Jugendlichen behandelt. Im Programm heißt es:
„Die frühe Nutzung von Social Media hat Auswirkungen auf die Gesundheit sowie die Lern- und Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, auch in der Schule. Diese werden wir schnellstmöglich wissenschaftlich basiert bewerten und ein Maßnahmenpaket zur Stärkung von Gesundheit- und Jugendmedienschutz vorlegen.“
- Auch soll ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des Jugendmedienschutzes, das gezielt gegen problematische Entwicklungen in sozialen Netzwerken vorgehen soll, auf die Bahn gebracht werden.
Was im Wahlprogramm von Bündnis90 / Die Grünen zu Social Media steht
- Im Programm von Bündnis90 / Die Grünen wird das Thema Social Media ebenfalls vor allem im Kontext des Jugendschutzes und der digitalen Teilhabe aufgegriffen.
- So wollen die Grünen Kinder und Jugendliche vor den psychischen und sozialen Risiken einer exzessiven Nutzung sozialer Medien schützen.
- Dazu zählen für sie strengere Regulierungen manipulativer Algorithmen, die gezielt darauf abzielten, junge Menschen süchtig zu machen, sowie datenschutzfreundliche Voreinstellungen (kids-safety-by-default) und zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen.
- Ferner sieht das Programm vor, dass Eltern durch entsprechende Sicherheitsfunktionen unterstützt werden, sowie ein Bürgerrat unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen eingerichtet wird, um aktuelle Fragen des digitalen Kinder- und Jugendschutzes zu adressieren.
- Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die sichere Teilhabe junger Menschen am Netz zu gewährleisten und die demokratischen Strukturen im digitalen Raum zu stärken.
- Sie sehen den DSA als möglichen Baustein, um manipulative Algorithmen einzudämmen und den Jugendschutz zu stärken – ohne dabei die digitale Debattenkultur zu beeinträchtigen.
Was im Wahlprogramm von Die Linke zu Social Media steht
- Die Linke fordert, dem „Machtmissbrauch“ durch digitale Monopole entgegenzuwirken, indem rechtliche Spielräume genutzt werden, um Monopole aufzubrechen.
- Zudem solle das Kartellrecht gestärkt und konsequent umgesetzt werden, um „unfaire Marktmachtstrukturen“ zu durchbrechen.
- Personalisierte Onlinewerbung soll verboten werden.
- Die Idee von Daten als „käufliches Eigentum“ wird abgelehnt.
- Last but not least sollen öffentliche und genossenschaftliche Plattformen als alternative, gemeinwohlorientierte soziale Netzwerke gefördert werden.
Was im Wahlprogramm der FDP zu Social Media steht
- Bei der FDP wird das Thema Social Media primär unter dem Aspekt des Schutzes der Meinungsfreiheit diskutiert.
- Die FDP fordert, dass die Sorgfaltspflichten, die im Rahmen des Digital Services Act an digitale Plattformen – also auch an soziale Medien – herangetragen werden, nicht dazu führen dürfen, dass die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird.
- Konkret soll verhindert werden, dass private Gerichte statt staatlicher Instanzen über die Grenzen der Meinungsfreiheit entscheiden, sodass die digitale Debattenkultur nicht unter übermäßiger Regulierung leidet.
Was im Wahlprogramm des BSW zu Social Media steht
- Das BSW fordert ein Social-Media-Gesetz nach australischem Vorbild. Im Wahlprogramm heißt es: „Statt krankmachender Social-Media-Algorithmen brauchen Kinder mehr Bewegung, Spaß und Freunde auch außerhalb der Schule.“
- Zudem sieht das BSW eine Tendenz, dass Menschen ihre Meinung nicht mehr frei äußern könnten. Dies stelle eine Gefahr für die Demokratie dar.
- Laut BSW beeinflusse der Staat das öffentliche Meinungsklima durch die Finanzierung von Projekten, Organisationen und "Faktencheckern", was die freie Meinungsbildung einschränke.
- Das BSW fordert daher, die staatliche Zusammenarbeit mit Medien und Organisationen zu beenden, die ihrer Meinung nach den öffentlichen Diskurs in eine bestimmte Richtung lenkten.
Was im Wahlprogramm der AfD zu Social Media steht
- Die AfD fordert die Beendigung jeglicher Finanzierung von NGOs, die ihnen zufolge in die freie Meinungsbildung eingreifen, sowie eine vollständige Offenlegung solcher Gelder. Wörtlich heißt es:
In letzter Zeit wird jedoch durch öffentlich-rechtliche sowie „nicht-staatliche“ Akteure versucht, die Meinungsfreiheit durch direkte Verbote oder Delegitimierung kritischer Meinungen einzu- schränken. Immer mehr öffentlich-rechtliche sowie nicht-staatliche Akteure, sogenannte „NGOs“, wie zum Beispiel „Faktenchecker“ oder „Correctiv“, werden über staatliche Beauftragung und Finanzierung für Desinformationskampagnen eingespannt.
- Und weiter:
Auch die Bundesregierung selbst nutzt den Einfluss auf Social- Media-Plattformen direkt zur Überwachung und Steuerung des Gedankenaustausches ihrer Bürger.
- Vor allem das NetzDG (das dazu da ist, Hass und Hetze von den Plattformen zu verbannen) führe zu einem „Eingriff in den freien Gedankenaustausch“. Es müsse daher laut AfD rückabgewickelt werden.
- Auch die EU-Initiative „Code of Practice on Disinformation“ sei laut AfD ausschließlich dazu da, legitime Meinungen als Desinformation abzustempeln und zu zensieren.
- Die Implementierung des europäischen Digital Services Act in Deutschland lehnt die AfD ab.
- All diese Maßnahmen begründet die AfD mit dem Schutz der Meinungsfreiheit.
Be smart
Die SPD hat überraschend viel zum Thema Social Media, Desinformationen und digitaler Meinungsbildung zu sagen. Die CDU hält sich dagegen eher bedeckt und sieht hauptsächlich die Jugend gefährdet. Die Linke fordert als einzige Partei, Plattformen jenseits der etablierten, kommerziellen Social-Media-Angebote zu fördern. BSW und AfD sehen in der Regulierung von Social-Media-Plattformen vorrangig den Versuch, unliebsame Meinungen zu unterdrücken.
Kein Wunder, dass die aktuelle US-Regierung die AfD so sehr umgarnt. Keine andere Partei in Deutschland fordert so vehement weniger Regulierung für die Social-Media-Plattformen.
Social Media & Politik
- Save Social: Der werte Kollege Björn Staschen hat gemeinsam mit vielen anderen besorgten Social-Media-Fans eine Petition (savesocial.eu) gestartet, um das freie Internet zu retten. Stand jetzt haben 178.941 Menschen unterschrieben, dass zum einen alternative Social-Media-Angebote gestärkt und zum anderen den Tech-Giganten Privilegien entzogen werden sollen — das Haftungsprivileg etwa müsse auf den Prüfstand, heißt es im Manifest. Spannend!
- Ist die Aufsicht des DSA unabhängig? Zur Einhaltung des DSA braucht es in jedem Land eine Institution, bei der der Digital Service Coordinator (DSC) angedockt ist. In Deutschland ist dies bei der Bundesnetzagentur der Fall. Da die Bundesnetzagentur jedoch eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums ist, stellt sich die Frage, wie unabhängig von politischer Einflussnahme der deutsche DSC ist. Eine neue Studie stellt Deutschland nun in dieser Angelegenheit ein durchaus befriedigendes Zeugnis aus. Netzpolitik hat die Details.
- X wehrt sich gegen Herausgabe von Daten: Gibt es bei der Bundestagswahl auf X eine Einflussnahme zugunsten der AfD oder des BSW? Beweisen lässt es sich bisher nicht. Dafür braucht es Daten. Die können über den DSA eingefordert werden. Das wollte die Gesellschaft für Freiheitsrechte gemeinsam mit Democracy Reporting International erreichen. Das Landgericht Berlin gibt ihnen recht. X aber wehrt sich nun gegen die Entscheidung. Als Grund gibt X an, dass das Landgericht Berlin gar nicht zuständig sei, da X seinen Sitz in Irland hat. Folglich müssten die Richter dort die Entscheidung treffen. Tja. Das wird uns wohl noch häufiger begegnen in den kommenden Monaten. Es geht in diesem Fall wohlgemerkt um den Zugang zu öffentlichen Daten! Es sollte also kein Problem für X sein, die Zugänge bereitzustellen. (Politico)
- X gibt EU-Kommission Informationen zu geänderten Algorithmen: Immerhin hat X der EU-Kommission jetzt einen Bericht zu den von ihnen vermutlich vorgenommenen Änderungen am Algorithmus übergeben (Zeit). Was im Bericht steht und ob die Infos brauchbar sind, wissen wir allerdings bisher nicht. Unsere Vermutung: 🫠
- Werden DSA und DMA zur Verhandlungsmasse? Die Tech-Konzerne hassen es, reguliert zu werden. Ihrer libertären Weltsicht nach, sollte der Staat, so viel es nur geht, zurückgebaut werden. Folglich muss ihnen das Regelwerk, das die EU mittels Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA) in Form gegossen hat, maximal zuwider sein. Kein Wunder also, dass Meta und die anderen Giganten, weiter recht schambefreit die Nähe zu Donald Trump suchen, um die in ihren Augen unfaire Behandlung (wir reden hier davon, dass EU-Recht zur Anwendung kommt), zu beenden (Bloomberg). DMA und DSA werden so immer stärker zu „bargaining chips“ in den wirtschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen der EU und den USA.
- Mehr zu dem Thema in unserem Gespräch mit den Wissenschaftlern des DSA 40 Data Access Collaboratory:
- TikTok ist wieder da — also in den App-Stores von Google und Apple: US-Generalstaatsanwalt Pam Bondi hat den beiden Unternehmen schriftlich zugesichert, dass ein Verbot nicht sofort durchgesetzt würde. Wie es weitergeht, bleibt offen. Berichten zufolge hat Trump seinen Vize JD Vance damit beauftragt, einen Deal auszuhandeln. (Bloomberg)
- Einen ausführlichen Hintergrund zum TikTok-Verbot in den USA findest du hier:

- OpenAI verspricht, keine Meinungen zu zensieren: Künftig wolle das Unternehmen bei den Sprachmodellen, auf denen Anwendungen wie ChatGPT beruhen, weniger streng regulieren. In einem Statement zum Update heißt es (OpenAI): „The (model) should not avoid or censor topics in a way that, if repeated at scale, may shut out some viewpoints from public life.” Tja, das riecht arg nach einem Versuch, gut Wetter mit der neuen Trump-Administration zu machen. Es hatte sich schon vor einigen Monaten angedeutet, dass KI das nächste Feld sein würde, auf dem Trumps Truppe dafür sorgt, dass sich ihre Interpretation von „freier Meinungsäußerung“ durchsetzt. (TechCrunch)
- Meta-CTO empfiehlt unzufriedenen Mitarbeiterïnnen zu kündigen: Es rumort bei Meta derzeit ordentlich. Immer wieder ist zu lesen, dass sich Mitarbeiterïnnen über den neuen Kurs der Firma intern irritiert zeigen und Antworten darauf einfordern, wie es etwa künftig noch um die Diversitätsbemühungen des Unternehmens bestellt ist. CTO Andrew Bosworth, der schon häufiger mit unangenehmen Statements aufgefallen ist, hat nun bei einer internen Fragerunde allen, die mit der neuen Ausrichtung unzufrieden sind, geraten, das Unternehmen zu verlassen (Business Insider). Well, das ist der Spirit 🙄
- X scheint "Signal-me"-Links zu blockieren: Wer auf X einen Link zu seinem Signal-Profil in DMs, Beiträgen oder Profilseiten teilen möchte, erhält in letzter Zeit immer öfter eine Fehlermeldung. Ein möglicher Grund: Signal ist eins der beliebtesten Tools für US-Bundesbedienstete, um darüber zu berichten, was bei DOGE passiert. (Substack / disruptionist)
Schon einmal im Briefing davon gehört
- KI-generierter Fan-Content von Musk und Trump: Nein, nein, nein! Elon Musk hat das so nicht gesagt! Auch das Video von Donald Trump ist nichts weiter als KI-generierter Click-Müll. Aber hey, die Leute feiern es. Sie danken Musk und Trump in den Kommentarspalten für ihre weisen Worte. Jesus Maria im Himmel. (404 Media)
- KI-generierter True-Crime-Müll: Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt, sich True-Crime-Stories auszudenken, um sie dann mit KI-generierten Personen zu reenacten und bei YouTube hochzuladen… Happy new AI-Slop-Time! (404 Media)
Neue Features bei den Plattformen
- WhatsApp testet ein neues exklusives Gruppenchat-Feature namens „The Chat“: Das Tool baut auf der bereits bestehenden WhatsApp-Funktion „Communities“ auf, bei der Nutzerïnnen an großen Gruppenchats teilnehmen, die auf gemeinsamen Interessen basieren. In Chats kann dann eine kleine Gruppe auserwählter Teilnehmer texte, Dritte können mitlesen, aber nicht kommentieren. (Adweek)
- Instagram testet einen Dislike-Button für Kommentare. (TechCrunch)
Bluesky
- BlueSkyHunter ist ein neuer Dienst, der professionellen Bluesky-Userïnnen ein Analytics-Dashboard sowie Tools zur Planung von Posts und zur Automatisierung von Direktnachrichten an die Hand gibt. (BlueSkyHunter)
In eigener Sache
Die lieben Kollegïnnen der taz haben uns eingeladen, beim taz lab am 26.4. über Social Media und Politik zu diskutieren. Im Vorfeld gab es nun diesen schmeichelhaften Artikel über unsere Arbeit. Wie schön ☺️


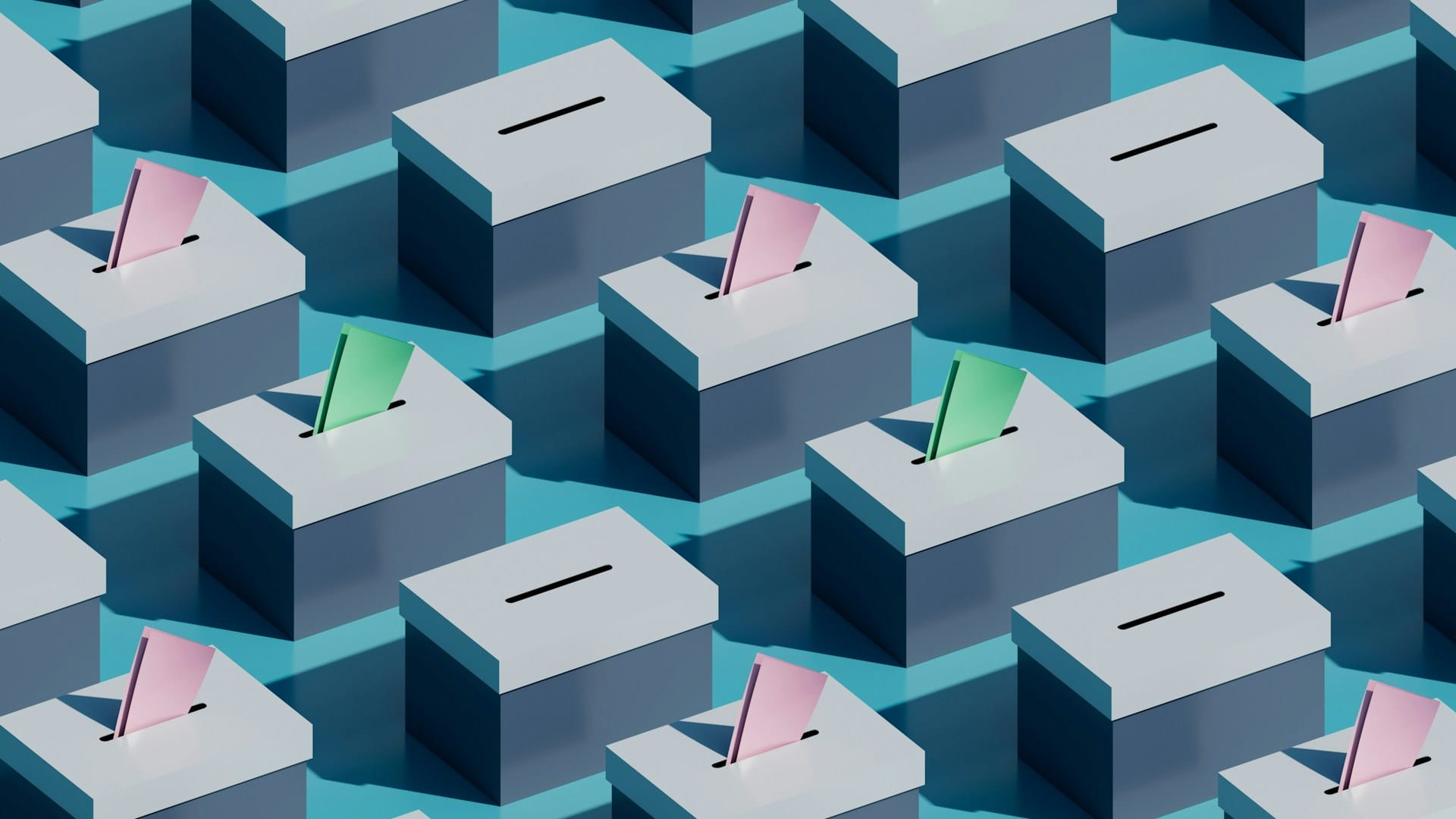




Mitglieder-Diskussion